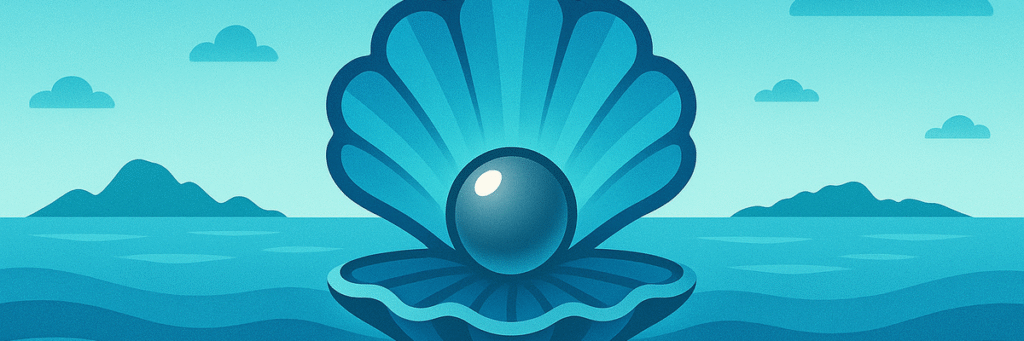Dies ist ein strategischer Wendepunkt für die polynesische Perlenzucht. Die Firma Belpearl, ein seit 1933 tätiger Perlenhändler, der für seine internationalen Auktionen bekannt ist, eröffnet ein Büro in Papeete. An diesem Samstag nahmen rund fünfzig Perlenzüchter an einem von dem Unternehmen im Intercontinental organisierten Symposium teil – ein klares Zeichen für den Willen, lokale Produzenten enger mit den Anforderungen des Weltmarktes zu verknüpfen.
Belpearl ist seit 1990 in Französisch-Polynesien präsent. Das Familienunternehmen wurde von der aus dem Libanon stammenden Familie Hajjar gegründet und begleitet bereits 25 lokale Farmen. Dank seiner Erfahrung in Japan, Hongkong und nun auch in Tahiti hat sich Belpearl als einer der wichtigsten Akteure im internationalen Perlenhandel etabliert.
Ein lokales Büro zur Bewertung, Sortierung und Vermarktung
Freddy Hajjar, zukünftiger Leiter des Büros in Papeete, erläutert das Konzept: „Wir werden im Stadtzentrum einen Ort einrichten, an dem die Perlenzüchter ihre Partien zur genauen Schätzung abgeben können. Viele wissen nicht, wie viel ihre Perlen tatsächlich wert sind, weil die Sortierung oft unzureichend ist.“
Belpearl plant, die Produzenten kostenlos in modernen Sortiertechniken zu schulen, die auf Technologien der künstlichen Intelligenz basieren, wie sie bereits in der Diamantbewertung verwendet werden. Diese Begleitung soll den Fachleuten helfen, besser auf die Markterwartungen zu reagieren.
Gerüchte bekämpfen und direkt informieren
Ziel dieser Initiative ist es auch, Unklarheiten rund um die Verkäufe zu beseitigen. „Wenn wir Perlen zu guten Preisen international verkaufen, hören wir vor Ort gegenteilige Gerüchte – das ist typisches Buschfunk-Radio. Es ist entscheidend, die Wahrheit zu sagen und den Züchtern die Werkzeuge zu geben, um ihre Verkäufe nachzuvollziehen und den Wert ihrer Produkte zu verstehen“, betont Freddy Hajjar.
Für Steve Pommier, Perlenzüchter in Arutua und Vorsitzender des Lagunenbewirtschaftungskomitees, ist diese neue Transparenz von großem Wert: „Wir konzentrieren uns oft auf die Produktion, ohne zu wissen, was die Käufer wirklich wollen. Dieser direkte Marktbezug hilft uns, unsere Aufzucht besser auf Qualität, Größe und Farbe auszurichten.“
Direkter Zugang zum Weltmarkt
Arii Sichoix, Perlenzüchter auf den Gambierinseln, begrüßt die Eröffnung des Büros: „Dank Belpearl haben wir Zugang zum Markt in Hongkong mit einer reduzierten Kommission von nur 5 %. Das beseitigt auch unsere Abhängigkeit von einem einzigen lokalen Zwischenhändler. Auch wenn dieser – Robert Wan – viel zu unserer Entwicklung beigetragen hat, ist es Zeit für einen Wandel.“
Die Ankunft von Belpearl in Tahiti ersetzt nicht die bestehenden Akteure, sondern erweitert die Absatzmöglichkeiten für Perlenzüchter und fördert eine offenere Marktstruktur.
Zuchtstationen: Der Schlüssel zur Lösung des Nacktmangel-Problems
Die internationale Dynamik allein reicht jedoch nicht aus, wenn der vorgelagerte Sektor zusammenbricht. „Die größte Herausforderung heute ist die Verknappung der Perlenausternlarven. Die natürliche Sammlung funktioniert aufgrund der Verschmutzung nicht mehr. Die Zukunft liegt in den Zuchtstationen“, betont Arii Sichoix, der plant, im kommenden März eine eigene Station auf den Gambierinseln zu eröffnen.
„Es dauert zwei Jahre von der Laichzeit bis zur Perlengewinnung. Wenn wir die Nachhaltigkeit der Branche sichern wollen, müssen wir jetzt handeln“, warnt er.
Steigende Preise, aber Vorsicht bleibt geboten
Der Markt für schwarze Perlen ist nach wie vor starken Schwankungen unterworfen. „Die Covid-Krise hat die Produktion gebremst, und die wirtschaftlichen Spannungen zwischen China und den USA haben sich ebenfalls negativ auf die Preise ausgewirkt“, erinnert Freddy Hajjar.
Doch die Anzeichen sind ermutigend. „Die Preise haben sich seit Covid fast verdoppelt. Wir sind von 600 auf 1.200 XPF pro Gramm gestiegen. Wenn die Nachfrage anhält, könnten wir sogar 1.800 XPF erreichen“, hofft er.
Weniger produzieren, aber in besserer Qualität
Die Devise ist klar: lieber weniger, aber hochwertiger produzieren. Belpearl kauft Perlen der Qualitätsstufen A bis D, zeigt aber auch Interesse an Perlen der Kategorie E, die nahe an Ausschussware liegen – aufgrund der hohen Nachfrage.
Mit erweiterten Absatzmöglichkeiten, gezielten Schulungen und technischer Unterstützung könnte die verstärkte Präsenz von Belpearl in Tahiti der Perlenbranche neuen Auftrieb verleihen – in einer Zeit, in der sie dringend Stabilität braucht.