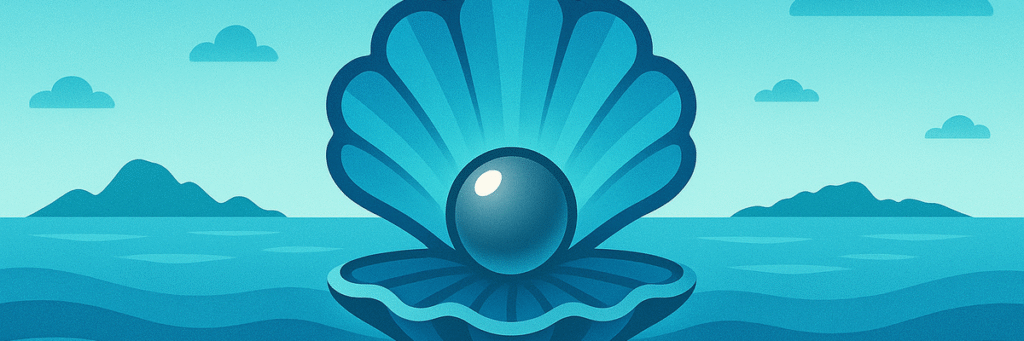Das Marine Resources Department (DRM) hat ein ehrgeiziges Projekt zur Förderung der Kreislaufwirtschaft durch das Recycling von Plastikschwimmern aus der Perlenzucht gestartet – einem Schlüsselsektor für Französisch-Polynesien, der aber auch eine bedeutende Quelle für Plastikmüll darstellt.
Im Jahr 2023 sammelte das DRM 6.000 Schwimmer auf den Gesellschaftsinseln und Tuamotu-Gambier im Rahmen einer Kampagne zum Recycling von Abfällen aus der Perlenzucht.
Ein Pilotprojekt zum Recycling von Plastikschwimmern
Die größte Herausforderung liegt in der Haltbarkeit der Schwimmer, die aus ABS-Kunststoff (Acrylnitril-Butadien-Styrol) bestehen und aufgrund ihrer Zähigkeit schwer zu zerkleinern sind. Das DRM hat jedoch einen Zerkleinerungsprozess getestet, um diese Schwimmer in Pellets umzuwandeln – eine Methode, die auf andere Inseln übertragen werden könnte, um das lokale Plastikmüllmanagement zu erleichtern.
Bisher wurde ein spezieller Schredder eingesetzt, und das Zerkleinern der Schwimmer reduziert das Abfallvolumen erheblich. Ein einziger „Big Bag“ kann bis zu 40 ganze Schwimmer aufnehmen, aber nach dem Schreddern fasst er das Äquivalent von 300 Schwimmern in Pelletform, was die Transportkosten und logistischen Herausforderungen drastisch senkt.
Lokale Auswirkungen und Recyclingpotenzial
Das Ziel des DRM ist es, diesen Zerkleinerungsprozess direkt an den Anlegestellen der betroffenen Inseln durchzuführen. Dies würde die Seetransportkosten senken und gleichzeitig eine Recyclinglösung vor Ort bieten. Zudem könnte die Verringerung des Schwimmervolumens ein nachhaltigeres Abfallmanagement unter Perlenzüchtern und anderen lokalen Akteuren fördern.
Perlenzüchter sind sich der Bedeutung des Recyclings zunehmend bewusst. Laut Marcelle Howard, Präsidentin des GIE Toarava, könnte das Recycling dieser Schwimmer nicht nur den Bedarf der Perlenzüchter decken, sondern auch andere Sektoren wie den Lagunentourismus versorgen, wo das Material wiederverwendet werden könnte – beispielsweise für die Herstellung von Stadtmöbeln.
Zukunftsaussichten und Herausforderungen
Das Pilotprojekt hat großes Interesse geweckt, insbesondere bei einem lokalen Akteur der Kunststoffindustrie, der die Fortschritte verfolgt. ABS-Kunststoff, der üblicherweise in Autostoßstangen verwendet wird, könnte ein zweites Leben in lokalen Anwendungen finden, wenn die Pellets die erforderlichen technischen Standards erfüllen.
Allerdings steht das Projekt vor einer großen Hürde: die Erholung des Perlenzuchtmarktes. Die Branche kämpft derzeit mit Schwierigkeiten, und die Nachfrage nach recycelten Schwimmern wird weitgehend von ihrer Erholung abhängen.
Fazit
Diese Recyclinginitiative für Plastikschwimmer markiert einen wichtigen Schritt zur Etablierung einer Kreislaufwirtschaft in Polynesien. Sie zeigt, wie der Perlenzuchtsektor eine aktive Rolle im Umweltschutz spielen kann, während er praktische und wirtschaftlich tragfähige Lösungen für das Plastikmüllmanagement entwickelt. Das DRM erkundet weiterhin innovative Ansätze, die Abfall schließlich in wertvolle Ressourcen für die Gemeinschaft verwandeln könnten.