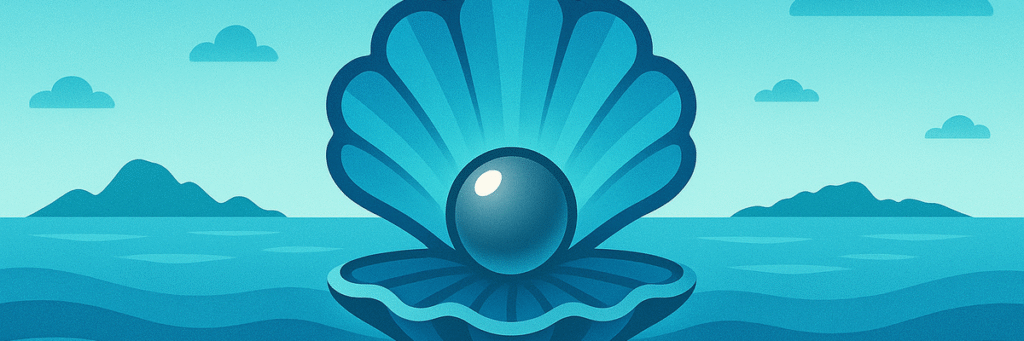Was wäre, wenn Perlaustern die Gesundheit von Lagunen überwachen könnten?
Diese kühne Vision steckt hinter Molluscan Eye – einem Startup eines ehemaligen Forschers, das Meeresbiologie mit Hightech verbindet. Im Januar sorgte das Unternehmen auf dem CES in Las Vegas mit seiner innovativen Umweltmonitoring-Lösung für Aufsehen.
Das Konzept?
Perlaustern mit intelligenten Sensoren ausstatten, die Wasserqualität in Echtzeit messen. Die Systeme sind bereits im Tuamotu-Archipel (u.a. auf den Atollen Takaroa und Takapoto) sowie weltweit im Einsatz – von der Arktis bis Neukaledonien.
Jean-Charles Massabuau, Mitgründer des Startups, erläutert:
„Wir hängen einen Käfig mit Austern in der Lagune auf. Eine Platine erfasst die Reaktionen der Weichtiere, eine andere überträgt die Daten via Mobilfunk.“
Die fernausgewerteten Informationen ermöglichen so eine lückenlose, echtzeitfähige Ökosystem-Überwachung – deutlich effizienter als klassische Methoden.
Warum überzeugt die Technologie?
- Einfachheit & Praxistauglichkeit: „Auf dem CES beeindruckte besonders, dass wir ein Tool für ein echtes Problem anbieten. Und das Verblüffendste? Manche begreifen erst jetzt, dass Wasser verschmutzt sein kann!“, so Massabuau.
- Bio-Indikatoren 2.0: Austern als lebende Sensoren liefern präzisere, schnellere Daten – ein Durchbruch für den Schutz polynesischer Lagunen.
Ein Modell mit globalem Potenzial
Molluscan Eye revolutioniert Umweltmonitoring: kostengünstig, skalierbar und symbiotisch mit der Natur. Eine Schlüsseltechnologie – nicht nur für die Perlenindustrie, sondern für die Zukunft fragiler Küstenökosysteme weltweit.