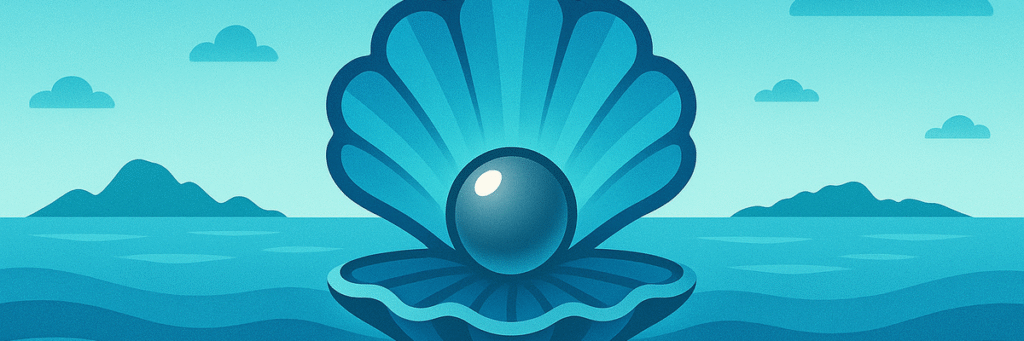Am 17. Oktober 2023 verkündete das Strafgericht von Papeete das Urteil in einem Betrugsfall mit Perlen, der die Perlenzuchtbranche erschüttert hatte.
Ein 70-jähriger Rentner, ehemaliger Mitarbeiter der OPT, wurde zu drei Jahren Haft verurteilt, davon sechs Monate ohne Bewährung, weil er ohne erforderliche Händlerlizenz illegal Perlen gekauft hatte. Sein Komplize, ein erfahrener Juwelier, erhielt eine sechsmonatige Bewährungsstrafe wegen Hehlerei.
Zwischen Dezember 2018 und Februar 2019 hatte der Rentner mehrere Chargen Perlen im Wert von über 20 Millionen Fcfp (XPF) von polynesischen Produzenten erworben. Verführt von einem früheren, sehr profitablen Investment, stieg er ohne Genehmigung in den Perlenhandel ein und nutzte betrügerische Methoden: Versprechen von Banküberweisungen, die nie eintrafen, Teilzahlungen in bar, gefälschte Überweisungsaufträge und sogar die Einbindung eines Komplizen am Telefon, um die Verkäufer zu beruhigen.
Diese betrügerischen Machenschaften stürzten mehrere Perlenzüchter in finanzielle Not, sodass einige sogar das Schulgeld ihrer Kinder nicht mehr bezahlen konnten. Der chinesische Händler, der seit Jahren in der Branche aktiv war, wurde schuldig gesprochen, Perlen von diesem Scheinhändler gekauft zu haben, ohne die Legalität seiner Geschäfte zu überprüfen.
Die Staatsanwaltschaft bezeichnete den Fall als „Spitze des Eisbergs“ und verwies auf einen schwer regulierbaren Parallelmarkt. Das Gericht ordnete eine gemeinsame Rückzahlung von über 18 Millionen Fcfp an die Opfer an.