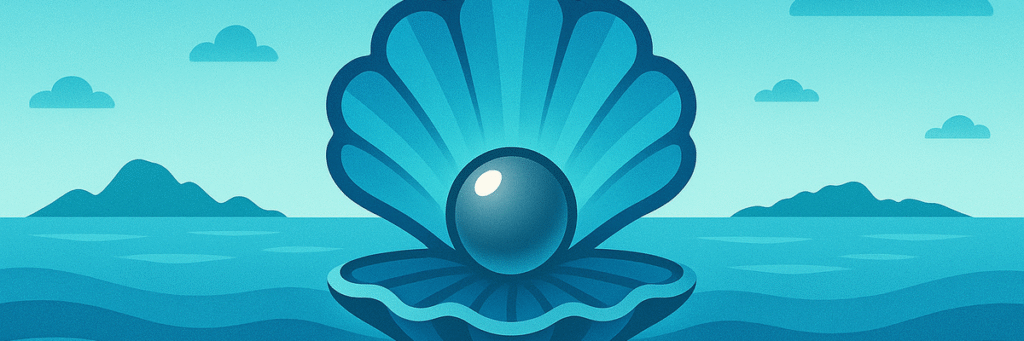Sturzflug der Zuchtperlen: Dramatischer Einbruch der Exporte
Die aktuellen Daten des ISPF, basierend auf Zahlen der Zolldirektion, offenbaren einen drastischen Rückgang der polynesischen Exporte im vierten Quartal 2024: Ein Wertverlust von 62% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im Jahresvergleich beträgt der Einbruch 47% – ein schwerer Schlag für die Wirtschaft Polynesiens.
Perlenindustrie im freien Fall
Als historisches Exportstandbein zeigt die Perlenbranche die deutlichsten Verluste:
- Rohperlen: -69% im Wert, -49% im Volumen
- Durchschnittspreis: Nur noch 700 F.CFP pro Gramm (-39% zum Vorjahr)
- Jahresbilanz: -59% im Wert, -52% im Volumen
Vanille und Noni: Lichtblicke in der Krise
Während die meisten Sektoren leiden, verzeichnen einige Agrarprodukte überraschende Zuwächse:
- Vanille: +76% Wert, +50% Volumen (59.000 F.CFP/kg)
- Noni: +64% Wert, +50% Volumen
Dagegen kämpfen andere traditionelle Exportgüter:
- Kopraöl: Leichter Wertanstieg (+33%) bei sinkenden Mengen (-21%)
- Monoï & Perlmutt: Wertrückgänge um 41% bzw. 26%
Importe: Gesamtstabilität mit Schieflagen
Die zivilen Importe zeigen zwar Stabilität, doch die Branchenentwicklungen divergieren stark:
- Investitionsgüter: +26% Wert (Unternehmensimporte +6%)
- Vorprodukte: -12% Wert trotz höherer Mengen (+37%, u.a. durch Zementkäufe)
- Privathaushalte: Leichter Rückgang (-2% Wert, -3% Volumen)
- Automobilmarkt: Einbruch um 30% im Wert
Energiesektor: Günstige Preise, steigender Verbrauch
Trotz 14% höherer Importmengen sank der Wert von Erdölprodukten um 14%. Im Jahresvergleich:
- Leichter Wertanstieg (+3%)
- Durchschnittspreis pro Kilo bei 100 F.CFP (-24%)
Die Zahlen zeichnen ein gemischtes Bild der polynesischen Wirtschaft, die nach wie vor zu stark von der Perlenindustrie abhängt.
(Quellen: ISPF, Zolldirektion)