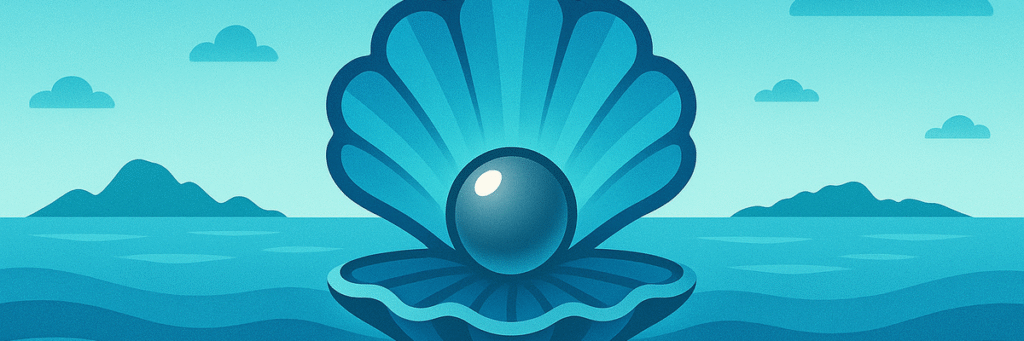Das Atoll Manihi, einst das pulsierende Herz der Perlenzucht in Französisch-Polynesien, hat seinen Glanz verloren, nachdem es in den 1980er und 90er Jahren über 70 Perlenfarmen beherbergte. Heute kämpfen weniger als zehn Farmen um ihr Überleben – belastet durch eine anhaltende Krise. Die einst blühende Branche hat sich noch nicht von dem dramatischen Preisverfall erholt, der die lokale Wirtschaft erschütterte.
Aufstieg und Niedergang der Perlenzucht
Die Perlenzucht in Französisch-Polynesien begann 1961 im kristallklaren Wasser des Hikueru-Atolls. Die Regierung, überzeugt vom Potenzial der Perlen, hatte bereits 1956 zehn Millionen Fcfp (Französische Pazifik-Franken) investiert, um die Pinctada margaritifera-Auster zu nutzen. Jean Domard, ein französischer Tierarzt und Leiter der Fischereibehörde, spielte eine Schlüsselrolle in diesem Erfolg und ebnete den Weg für die goldene Ära der Branche.
Im Dezember 1963 brachte die erste Ernte kommerziell verwertbarer runder Perlen 276 Edelsteine hervor. Dieser Durchbruch führte zu Transplantationsversuchen in Bora Bora, doch private Unternehmen übernahmen bald die Führung. Manihi wurde 1968 mit der Gründung der Société Perlière de Manihi (SPM) durch Jacques Rosenthal und den australischen Biologen William Reed zum ersten Standort privater Perlenfarmen.
In den folgenden Jahren breitete sich die Perlenzucht auf die Tuamotu-, Gambier- und Gesellschaftsinseln aus, während die Austral- und Marquesas-Inseln unberührt blieben. Doch Überproduktion – gepaart mit Managementfehlern und fragwürdigen politischen Entscheidungen – löste einen drastischen Preisverfall aus. 1990 kostete ein Gramm Perlen noch 6.490 Fcfp, doch bis August 2003 stürzte der Preis auf nur noch 800 Fcfp ab.
Eine schwindende Branche, ein verbliebener Hoffnungsschimmer
Heute kämpfen tahitianische Perlen um ihre Wiederbelebung – ihre Glanzzeit ist längst Vergangenheit. Viele Farmen schlossen, zurück blieben Ruinen und Hunderte verlorene Arbeitsplätze. Dennoch halten einige familiengeführte Betriebe durch, oft gestützt durch die Aufzucht von Austernlarven.
Ein Besuch der Temotu Perles von Michel Grillot in der Nähe der Pension Poerani Nui zeigt diese kleinen, widerstandsfähigen Unternehmen, die ums Überleben kämpfen. Zwar ist die Anzahl der Transplantationen geschrumpft, doch der Pioniergeist, der einst die Branche aufbaute, lebt weiter. Trotz aller Herausforderungen bleibt die Qualität der Perlen hoch, und die Preise sind wettbewerbsfähig.
Diese Reise in die Welt der Perlenzucht Manihis bietet einen faszinierenden Einblick in eine schwindende, aber hoffnungsvolle Industrie. Sie wird Abenteurer und Geschichtsenthusiasten gleichermaßen fesseln – und erinnert an die Legenden von Pionieren wie Henry de Monfreid, dessen Perlenjagden im Roten Meer und am Horn von Afrika unvergessliche Spuren hinterließen.