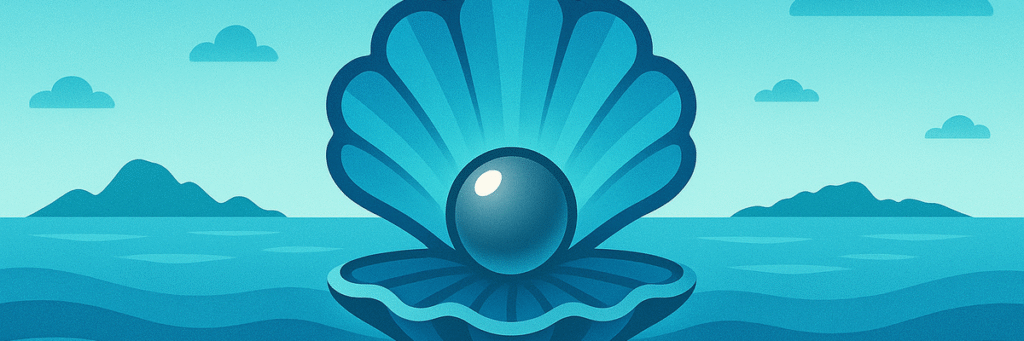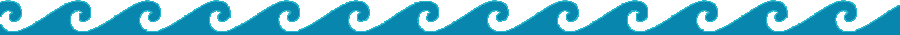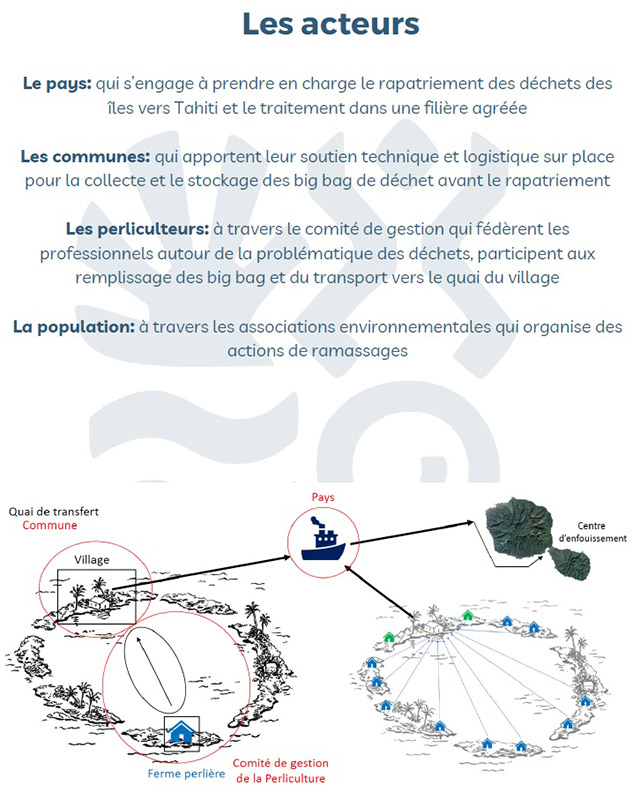Schlussfolterndes Urteil des Rechnungshofs zur Tahiti-Perlen Vereinigung (TPAFP)
Die Untersuchung des Territorial Audit Court (CTC) offenbart schwerwiegende Mängel in Management, Repräsentativität und Effektivität der TPAFP. Die Kernpunkte:
1. Mitgliederschwund & mangelnde Repräsentanz
- Gründung 2014 als Nachfolger von „La Maison de la Perle“
- Mitgliederzahl sank im ersten Jahr von 11 auf nur 5 Organisationen
- Aktuell repräsentiert die TPAFP nur 33% der lizenzierten Betriebe
- Schwere Glaubwürdigkeitskrise in der Branche
2. Systemisches Führungsversagen
- Keine systematische Protokollführung von Entscheidungen
- Generalversammlung erfüllt ihre Kontrollfunktion nicht
- Statutarische Regeln werden regelmäßig missachtet
- Keine wirksamen Maßnahmen gegen Interessenkonflikte
3. Finanzchaos trotz Millionensubventionen
- 436 Mio. Fcfp (2014-2019) ohne klare Mittelverwendung
- Mangelhafte Buchführung und interne Kontrollen
- Intransparente Ausgaben öffentlicher Gelder
- Keine effektive Aufsicht über Ressourcenverteilung
4. Gescheiterte Vermarktungsstrategie
- Internationale Förderung ohne direkte Kontrolle outgesourct
- Überteuerte Ausgaben ohne Wettbewerbsverfahren
- Bevorzugung bestimmter lokaler Anbieter
- Fehlende messbare Erfolge der Marketingaktivitäten
5. Reformbedarf: Mehr als Kosmetik nötig
- Teilreformen 2020 (direkte Partnerschaften) unzureichend
- CTC fordert grundlegende Neubewertung der Vereinigung
- Kernempfehlungen:
- Transparente Entscheidungsprozesse
- Strikte Finanzkontrollen
- Fokus auf nachweisbare Werbewirkung
6. Existenzfrage für die TPAFP
Die Vereinigung steht am Scheideweg:
- Vertrauensverlust in der Branche
- Zweifel an der Fähigkeit, Tahiti-Perlen wirksam zu vermarkten
- Ohne radikale Reform droht die Bedeutungslosigkeit
Fazit:
Die TPAFP muss sich entweder fundamental reformieren oder riskiert, als gescheitertes Projekt die polynesische Perlenindustrie im Stich zu lassen – mit schwerwiegenden Folgen für einen Schlüsselsektor der Wirtschaft Französisch-Polynesiens.