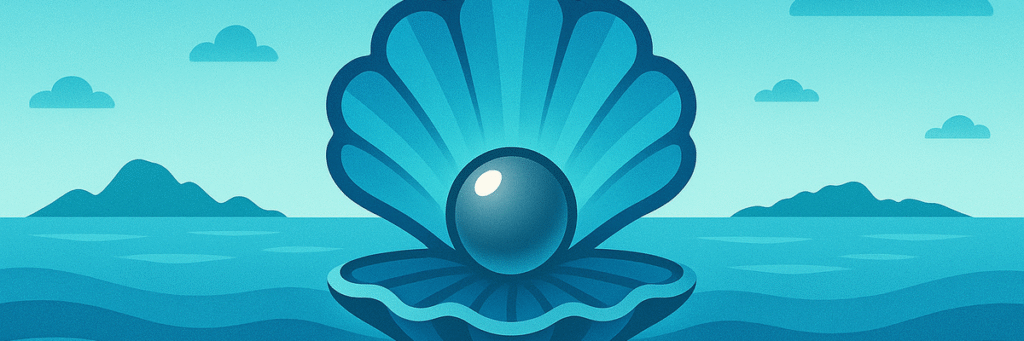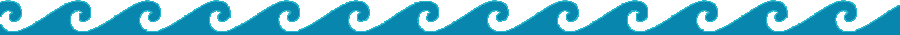Der Perlensektor in Französisch-Polynesien, bereits vor der Pandemie geschwächt, durchlief 2019 und 2020 eine tiefe Krise, gekennzeichnet durch einen starken Rückgang der Exporte und historisch niedrige Preise pro Gramm Perle.
Laut aktuellen Studien des französisch-polynesischen Statistikinstituts (ISPF) begann die Krise bereits lange vor COVID-19, mit ersten Anzeichen eines Rückgangs schon 2018.
Die Statistiken sind alarmierend:
- Die Zahl der Perlenauster-Produzenten sank 2020 um 8%, nach einem Rückgang von 1% im Jahr 2019
- Die Anbauflächen schrumpften innerhalb von drei Jahren um 12,7%
- Die Perlenproduktion fiel um 26%, von 9,1 Millionen auf 6,7 Millionen post-produktiv geprüfte Perlen
Der Preis für Rohperlen stürzte zwischen 2019 und 2020 um 51% ab – von 485 Fcfp auf nur noch 270 Fcfp -, hauptsächlich bedingt durch:
✓ Geringere globale Nachfrage
✓ Den Zusammenbruch der Handelswege nach Asien
Die Exporte brachen innerhalb von drei Jahren um 70,4% ein, mit einem Rückgang von 50% allein im Jahr 2020 (Gesamtwert: nur 2,4 Milliarden Fcfp).
Trotz dieser alarmierenden Zahlen zeigen frühe Daten aus 2021 eine leichte Erholung, wobei die Exporte bereits das Niveau von 2020 übertreffen. Diese Anzeichen einer Erholung geben Hoffnung für die Zukunft des Sektors, auch wenn strukturelle Reformen notwendig bleiben, um die Branche langfristig zu stabilisieren.